Mit den Worten " Etliche Studien befassen sich mit der
´┐Żkologischen Lage am Aralsee , aber kaum jemand fragt, wie es den Menschen dort
geht " startete Jan Small 1997 mit einem kleinen Krankenhaus in Kungrad ein Projekt zur Bek´┐Żmpfung der grassierenden
multiresistenten Tuberkulose.
Seither arbeiteten die ´┐Żrzte ohne Grenzen hier, im Nordwesten Usbekistans, lange
Zeit als einzige Hilfsorganisation in einem verarmten, verseuchten, ja von der
Welt schon fast vergessenen Land.
Die Umweltorganisationen der vereinten Nationen erkl´┐Żrten die Aralsee-Region
1992 zum Katastrophengebiet. Die Ausma´┐Że der Sch´┐Żden sind mit denen von
Tschernobyl vergleichbar.
Durch Fehlwirtschaft wurde das Land noch zu Sowjetzeiten mit Tonnen an D´┐Żnger
und Pestiziden verseucht.
F´┐Żr den gro´┐Żfl´┐Żchigen Anbau von Baumwolle und Reis wurde vor allem dem
wichtigsten Zulauf des Aralsees Amudarja jahrzehntelang das Wasser abgegraben.
Der Fluss und der viertgr´┐Ż´┐Żte Binnensee dieser Erde begannen auszutrocknen, zu
versalzen und zu verlanden.
Zudem wurde seinerzeit auf der im Aralsee liegenden und mittlerweile zur
Halbinsel verlandeten "Insel der Wiedergeburt" ein sowjetisches Forschungslabor
f´┐Żr biologische Waffen betrieben.
Die Auswirkungen dieser Verseuchung sind bis heute nicht einzusch´┐Żtzen.
Die Menschen in dieser Region wurden nicht nur durch vergiftete Nahrung und
verseuchtes Wasser schwer krank, sondern auch durch belasteten W´┐Żstenstaub, der
sich ´┐Żber die Luft weit verbreitete.
Sehr viele Menschen erlitten Darm- und Atemwegserkrankungen. Viele Frauen
erkrankten an einer An´┐Żmie; Kinder kamen missgebildet zur Welt.
Trotz dieser verheerenden Folgen hatten die Menschen anfangs zumindest noch eine
medizinische Grundversorgung, die aber mit der Unabh´┐Żngigkeit Usbekistans 1991
zusammenbrach.
Das Land verarmte zusehends, ein ´┐Żffentliches Gesundheitswesen war nicht mehr
aufrechtzuerhalten und die Zahl der Tuberkulose- Infizierten explodierte.
Das Zentrum der Arbeit von ´┐Żrzte ohne Grenzen verlagerte sich von Kungrad in ein
B´┐Żro nach Nukus, der Regionalhauptstadt Karakalpakstans, in dessen Umgebung drei
Krankenh´┐Żuser aufgebaut wurden.
Aus Schutz vor der Intimsph´┐Żre der Patienten und aufgrund der potentiellen
Ansteckungsgefahr war der Besuch eines Krankenhauses nicht erlaubt.
So f´┐Żhrten wir ein Gespr´┐Żch mit der sehr engagierten Projektleiterin Carla,
einer Krankenschwester aus den Niederlanden, um uns direkt vor Ort ´┐Żber die Situation zu informieren.
Die Kontakte zu der Organisation kn´┐Żpften wir bereits im Vorfeld ´┐Żber einen
hilfsbereiten Arzt aus Berlin, dem Hauptsitz der ´┐Żrzte ohne Grenzen in
Deutschland.
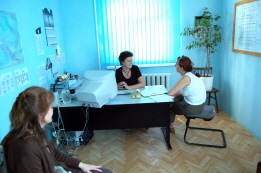
|

|
Das Team von insgesamt acht internationalen Mitarbeitern, darunter u.a. auch
´┐Żrzte und Logisten, arbeiten mit dem Ziel, einheimischen Medizinern das
sogenannte Dots-Programm zu vermitteln. "Dots" steht als ein englisches K´┐Żrzel
f´┐Żr eine sorgf´┐Żltig kontrollierte Therapie.
Unter strengster Medikamentenkontrolle und Quarant´┐Żne werden Infizierte f´┐Żr
mindestens zwei Monate station´┐Żr behandelt. Die krankmachenden Keime werden in
eigens eingerichteten Laboratorien kontinuierlich und sehr genau untersucht.
Die Patienten sind w´┐Żhrend ihres Aufenthaltes isoliert, m´┐Żssen bis zu 20
Tabletten t´┐Żglich einnehmen und leiden unter den sehr starken Nebenwirkungen,
wie extremer ´┐Żbelkeit und
schwersten Depressionen.
Anschlie´┐Żend werden sie bis zu zwei Jahre regelm´┐Ż´┐Żig h´┐Żuslich betreut, um den
weiteren Krankheitsverlauf und die weitere Tabletteneinnahme zu verfolgen.
Auf diese Weise liegt die Heilungsrate bei 60%.

|
Carla leistet diese Hausbesuche, die mit sehr viel sozialer Arbeit verbunden
sind.
Mit einem Dolmetscher und einem Fahrer an ihrer Seite, f´┐Żhrt sie tagt´┐Żglich zu
den kranken Menschen, die weit verstreut um diese Gegend wohnen.
Traurig erz´┐Żhlt sie, dass es immer wieder Menschen gibt, die an der
Medikamenteneinnahme verzweifeln. Einige sind so arm, dass sie sogar versuchen,
ihre Medikamente auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen.
Unerm´┐Żdlich kl´┐Żrt sie die Betroffenen auf, leistet ihnen und ihren Angeh´┐Żrigen
seelischen Beistand und nimmt Anteil an ihrem Schicksal.
Sie meint, dass Projekt werde vielleicht noch f´┐Żr drei Jahre weiterbewilligt.
Die Hilfe sei eingeleitet worden und werde begleitet, bis sie schlie´┐Żlich in die
Verantwortung der usbekischen Gesundheitsbeh´┐Żrde ´┐Żbergeben werden k´┐Żnne. Leider
seien aber die Medikamente der multiresisten Tuberkulose und ihre weitere
Erforschung ´┐Żberaus kostspielig.
Wir sp´┐Żren, dass Carla das Land und die Leute lieben gelernt hat. Es bricht ihr
fast das Herz, dass sie nun bald, nach geplanten zwei Jahren Arbeitszeit, das
Land wieder verlassen muss.